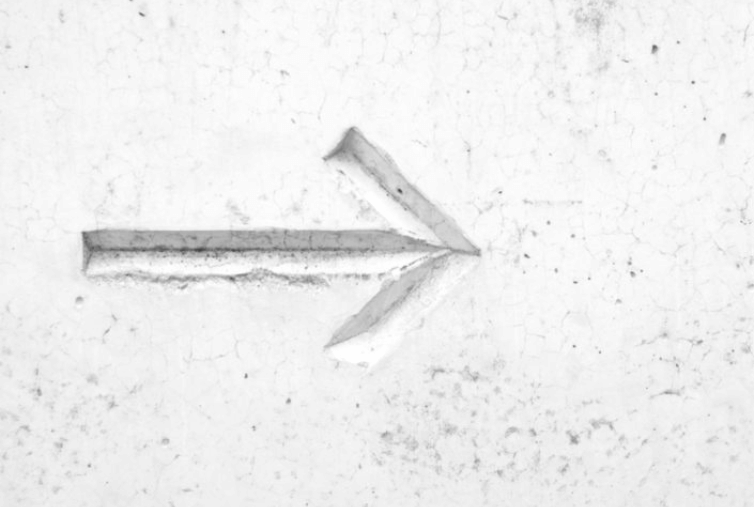Die Verbandsklage auf Abhilfe (§§ 623 ff ZPO) stellt ein für Österreich neuartiges Instrument des kollektiven Verbraucherrechtsschutzes dar, das bis dato auch noch nicht genutzt worden ist: Derzeit ist noch kein Abhilfeverfahren gerichtsanhängig.
Die innerstaatliche Abhilfeklage kann prototypisch als Leistungsklage (zB: Schadenersatz, gewährleistunsgrechtliche Nachbesserung oder -lieferung, Rückzahlung der Kaufpreiszahlung; die Unterlassungsklage ist eigens in §§ 619 ff ZPO geregelt) durch eine Qualifizierte Einrichtung (nach dem Qualifizierte-Einrichtung-Gesetz [QEG]; siehe dazu Beitrag 2 zu dieser Serie) erhoben werden und richtet sich zwingend gegen einen Unternehmer. Zuständig ist das Handelsgericht Wien. Der Status als Qualifizierte Einrichtung wird entweder direkt durch Gesetz verliehen (§ 3 QEG, zB: ÖGB, BAK, VKI) oder nach Prüfung der jeweiligen Voraussetzungen (§§ 1 f QEG: etwa personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung, entsprechender satzungsmäßiger Zweck) durch Bescheid des Bundeskartellanwaltes und ist einer bei dem Bundeskartellamt auf dessen Homepage geführten Liste zu entnehmen.
Kollektive Verbraucherinteressen werden dann ausreichend repräsentiert, wenn bereits bei Klageerhebung auf im Wesentlichen gleichartigen Sachverhalt basierende Ansprüche von mindestens 50 Verbrauchern gegen denselben Unternehmer geltend gemacht werden. Dabei ist ein „Opt-In-Verfahren“ vorgesehen: Verbraucher müssen sich vor Klageerhebung bei der Qualifizierten Einrichtung, die auf ihrer Homepage über eine geplante Abhilfeklage informiert, melden und auf diesem Wege der Klage „beitreten“.
Alle die genannten Kriterien sind Teil der Zulässigkeit der Klage; liegt eine Voraussetzung nicht vor, so ist die Klage zurückzuweisen. Das gilt auch für den Fall, dass die klagende Entität die Voraussetzungen der §§ 1 f QEG schon bei Klageerhebung nicht erfüllt oder diese im Laufe des anhängigen Abhilfeverfahrens nicht mehr vorliegen; wenn im zuletzt genannten Falle der Entität der Status als Qualifizierte Einrichtung durch den Bundeskartellanwalt entzogen wird, ist die Abhilfeklage sodann als unzulässig zurückzuweisen (§ 629 Abs 3 ZPO).
Das Handelsgericht Wien prüft zu Beginn des Verfahrens die genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen der Abhilfeklage und veröffentlicht die Entscheidung über die Durchführung für vier Monate in der Ediktsdatei (§ 627 ZPO). Sofern das Abhilfeverfahren zugelassen wird, können weitere Verbraucher binnen dreier Monate nach Veröffentlichung der Entscheidung über die Durchführung der Abhilfeklage – wie gehabt über die klagende Qualifizierte Einrichtung – auch nachträglich „beitreten“. Ein Austritt des beigetretenen Verbrauchers während des laufenden Verfahrens ist hingegen nicht möglich (§ 628 Abs 5 ZPO).
Durch den Beitritt wird die Verjährung des betroffenen Anspruches des Verbrauchers gehemmt. Der Beitritt führt weiters dazu, dass dessen Anspruch, der nunmehr auch Teil der Abhilfeklage ist, nicht mehr in einem separaten Verfahren (eigener Individualprozess oder weitere Abhilfeklage) geltend gemacht werden kann (Streitanhängigkeit) und im Falle einer Sachentscheidung (Stattgabe oder Abweisung der Abhilfeklage) der beigetretene Verbraucher gebunden ist (Rechtskrafterstreckung). Vice versa kann ein bereits in einem Individual- oder anderem Abhilfeverfahren anhängiger oder entschiedener Anspruch eines Verbrauchers nicht Gegenstand des nunmehrigen Abhilfeverfahrens sein.
Rechtstechnisch handelt es sich bei dieser Konstruktion uE um eine Prozessstandschaft, weil eine Qualifizierte Einrichtung – abweichend von herkömmlichen Verfahren – im eigenen Namen über fremde Ansprüche (namentlich der beigetretenen Verbraucher) prozessiert. Die Abhilfeklage wird daher weder wie die Verbandsklage auf Unterlassung nach § 28 KSchG (wegen unzulässiger AGB) noch wie die Sammelklage nach Abtretung von Ansprüchen über einen eigenen Anspruch des klagenden Verbandes geführt.
Über weitere Besonderheiten der Verbandsklage auf Abhilfe berichten wir in unserem 4. Teil dieser Beitragsreihe.