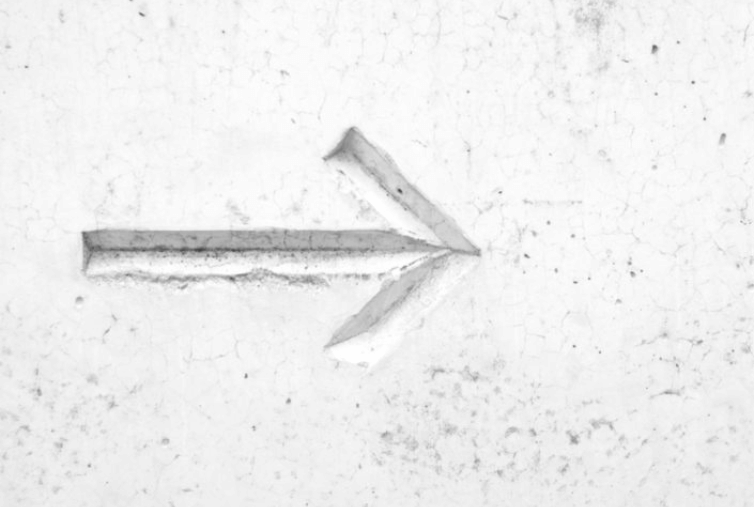Eine rezente Entscheidung des Obersten Gerichtshofes behandelt einen Fall des gutgläubigen Eigentumserwerbs an Kunstwerken, die vormals zur Ausstattung eines unter Denkmalschutz stehenden Schlosses gehörten. Das Schloss und seine damalige Ausstattung waren im Jahr 1939 unter Denkmalschutz gestellt worden. Davon waren auch die im konkreten Gerichtsverfahren relevanten Wandbespannungen mit Schlachtendarstellungen umfasst.
Die Wandbespannungen, die zivilrechtlich als Zubehör zu qualifizieren waren, durften somit nicht aus dem Schloss entfernt und veräußert werden. Ein Verbotsverstoß führt in solchen Fällen dazu, dass der Verkauf nichtig ist (§ 879 Abs. 1 ABGB). Im konkreten Fall erfolgte die verbotswidrige Veräußerung zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt. Die in diesem privatautonomen Akt enthaltene Aufhebung der Zubehöreigenschaft war somit rechtsunwirksam (siehe schon OGH 6 Ob 266/11b: Perpetuierung der Zubehöreigenschaft); gleichwohl wurden die Wandbespannungen aus dem Schloss weggebracht.
Fraglich war im entscheidungsgegenständlichen Fall, ob die Perpetuierung der Zubehöreigenschaft auch einen späteren Gutglaubenserwerb von einem befugten Unternehmer (§ 367 ABGB) verhindert. Denn es erfolgten weitere Veräußerungen durch Galeristen.
Eine Voraussetzung für den Gutglaubenserwerb nach § 367 ABGB ist, dass der Erwerber einen gültigen Titel für den Erwerb der Sachen abgeschlossen hat. Würden die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (etwa §§ 4, 36 und 37 DMSG) die Wirksamkeit des Kaufvertrages verhindern, dann gäbe es auch keinen gutgläubigen Eigentumserwerb. Nicht jedes Rechtsgeschäft, das in irgendeiner Weise gegen die Rechtsordnung verstößt, ist nichtig; ist eine solche Rechtsfolge nicht eigens angeordnet, könnte sich die Nichtigkeit aber aus dem Zweck der verletzten Norm ergeben.
Während der erste Verkauf der Wandbespannungen, der mit der Entfernung aus dem Schloss in Verbindung stand, nichtig war, trifft dies auf die folgenden Rechtsgeschäfte grundsätzlich nicht zu. Der OGH hält erstmals fest, dass das Denkmalschutzgesetz nicht die Nichtigkeit solcher Nachfolgegeschäfte anordnet und dass auch der Normzweck keine Nichtigkeit verlangt: Der Schutzzweck rechtfertige nicht, dass man eine bereits in Verkehr gebrachte Sache dem Rechtsverkehr zur Gänze entzieht. Zudem würde durch die Beendigung der Zubehöreigenschaft, welche durch die Wirksamkeit des Eigentumsübergangs eintritt, die denkmalschutzrechtliche Einheit auch nicht aufgehoben. Das Denkmalschutzgesetz begnügt sich mit der Verhängung anderer Rechtsfolgen (siehe etwa § 36 DMSG) als jener der Nichtigkeit. Zudem verweist der OGH auf die nach herrschender Ansicht bestehende Möglichkeit, auch an gestohlenen oder geraubten Kunstwerken gutgläubig Eigentum zu erwerben; den Eigentumserwerb bei einem Nachfolgegeschäft wegen eines Verstoßes gegen das Denkmalschutzgesetz abzuschneiden, wäre ein „massiver Wertungswiderspruch“.
Der erste gutgläubige Erwerber der Wandbespannungen konnte diese somit auch weiterveräußern, ohne dass es in der Folge auf die Gutgläubigkeit des Folgeerwerbers ankam. Der Beklagte des Rechtsstreits hatte zwei Schlachtendarstellungen in einem Antiquariat erworben; dem waren zumindest zwei Erwerbsvorgänge vorausgegangen. Die Klägerin hatte zwar die Gutgläubigkeit bei allen Erwerbsvorgängen bestritten, war ihrer Behauptungs- und Beweispflicht aber offenbar nicht hinreichend nachgekommen. Im Zweifel war daher die Redlichkeit zu vermuten und ein Gutglaubenserwerb zu bejahen.
Die OGH-Entscheidung klärt somit eine praktisch interessante Frage an der Schnittstelle von Zivilrecht und Denkmalschutzrecht. Zum Erwerb und zur Veräußerung von Kunstwerken siehe auch Rauter in Pfeffer/Rauter (Hrsg), Handbuch Kunstrecht, 2. Auflage (2020) 179 ff.