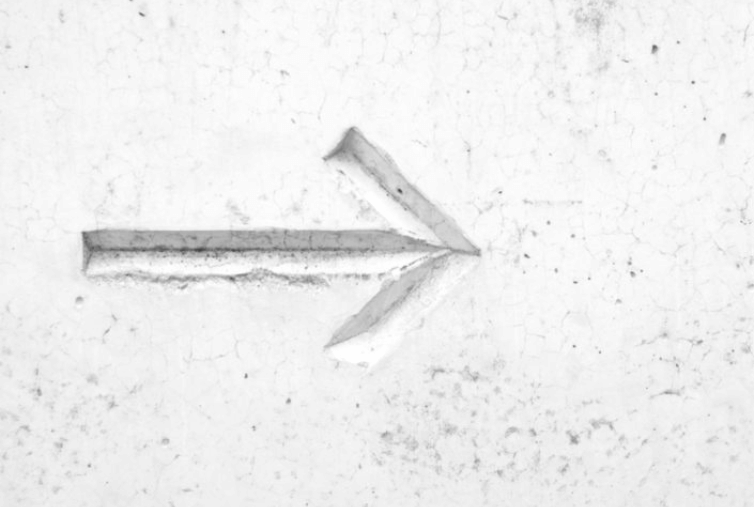In der Praxis bestehen bei dem Übergang eines Mietverhältnisses auf den Liegenschaftskäufer regelmäßig Unklarheiten.
So etwa auch in der Rechtssache OGH 4 Ob 45/24g: Der Beklagte ist der ursprüngliche Eigentümer und Vermieter eines Seegrundstückes. Der Kläger wiederum ist Eigentümer eines nicht an den gegenständlichen See angrenzenden Grundstückes (Binnengrundstück), der das Seegrundstück zum Zwecke des Seezuganges mietete. Der Mietvertrag war auf unbestimmte Zeit geschlossen worden und sah als Kündigungsbeschränkung im Kern vor, dass das Mietverhältnis „nur im Falle der Veräußerung [des Binnengrundstückes]“ enden könne.
Der ursprüngliche Vermieter und Eigentümer verkaufte das Seegrundstück. Der neue Vermieter und Eigentümer kündigte sodann das Mietverhältnis mit dem Mieter auf. Nachdem der Mieter den Kündigungsprozess gegen den neuen Vermieter verloren hatte, klagte er den ursprünglichen Vermieter wegen rechtswidrig und schuldhaft unterlassener Überbindung der obgenannten Kündigungsebeschränkung ua auf Ersatz der Schäden, die aus der Kündigung des Mietverhältnisses resultierten (Kosten der Beschaffung einer gleichwertigen Badegelegenheit).
Aufgrund der vorliegenden Flächenmiete ist das MRG (Raummiete) nicht anwendbar, sodass § 1120 ABGB im Zentrum der Entscheidung steht.
Im Allgemeinen gehen schuldrechtliche Verträge zwischen Verbrauchern im Falle der Einzelrechtsnachfolge (zB Kauf) nicht automatisch auf den Erwerber über, sondern bedarf es einer (allseitigen) Vertragsübernahme. Für Mietverhältnisse (ebenso wie für Pachtverhältnisse) enthält § 1120 ABGB aber eine Sonderregelung: Sie gehen von Gesetzes wegen dann auf den Erwerber über, wenn dem Mieter im Zeitpunkt des Eigentumserwerbes (Einverleibung des Eigentumsrechtes des Erwerbers im Grundbuch) das Mietobjekt bereits übergeben war.
Gleichsam als Entgegenkommen für die automatische Mietvertragsübernahme kommt dem Erwerber ein besonderes Kündigungsrecht gemäß § 1120 ABGB zu: Er ist trotz Übernahme des Mietverhältnisses nicht an – gemessen an dem dispositiven Recht – für ihn nachteilige vertragliche Kündigungsbeschränkungen (zB: längere Kündigungsfristen oder spätere Kündigungstermine; Kündigungsverzicht des Vermieters) gebunden, sondern kann er das Mietverhältnis nach den gesetzlichen Kündigungsmodalitäten auflösen.
Die vollinhaltliche Übertragung des Mietverhältnisses, das heißt inklusive Bindung an die für den Erwerber nachteiligen vertraglichen Kündigungsbeschränkungen, besteht nur dann, wenn entweder der Mietvertrag im Grundbuch als Belastung der erwerbsgegenständlichen Liegenschaft angemerkt ist (die Anmerkung beseitigt also die privilegierte Auflösungsmöglichkeit des Erwerbers nach § 1120 ABGB) oder die konkrete Kündigungsbeschränkung aus dem Mietvertrag auch mit dem Erwerber (neuer Vermieter) vereinbart wird, wozu der Veräußerer (ursprünglicher Vermieter) verpflichtet werden kann (Überbindung).
Im vorliegenden Fall sah der gegenständliche Mietvertrag keine Pflicht des Vermieters zur Überbindung der Kündigungsbeschränkung (Auflösung des Mietverhältnisses „nur im Falle der Veräußerung [des Binnengrundstückes]“) an den Erwerber vor und ergibt sich auch aus § 1120 ABGB keine gesetzliche Überbindungspflicht. Die Kündigung durch den neuen Vermieter war daher wirksam und bestand mangels rechtswidrig und schuldhaft unterlassener Überbindung der Kündigungsbeschränkung auch kein Schadenersatz des gekündigten Mieters gegenüber dem ursprünglichen Vermieter.
Hinweise für die Praxis:
Aus Sicht des Mieters folgt daraus, dass am besten direkt in dem Mietvertrag vorgesehen werden sollte, dass der Vermieter einem etwaigen Erwerber der Liegenschaft die konkreten Kündigungsbeschränkungen aus dem Mietverhältnis zu überbinden hat und dass dies auch für weitere Erwerber gilt.
Naturgemäß können Kündigungsbeschränkungen nur dann dem Erwerber überbunden werden, wenn sie wirksam vereinbart worden sind. Der OGH vertrat in dem vorliegenden Fall die Ansicht, dass die konkrete vertragliche Kündigungsbeschränkung (das Mietverhältnis könne „nur im Falle der Veräußerung [des Binnengrundstückes] enden) sittenwidrig ist, weil sie auch das vertraglich nicht einschränkbare außerordentliche Kündigungsrecht (dieses steht in besonders gravierenden Fällen immer dann zu, wenn der Fortbestand der Vertragsbeziehung für den Vertragspartner unzumutbar ist) umfasst. Die gesamte Kündigungsbeschränkung war laut OGH daher zur Gänze unwirksam, sodass es auf die Frage der Überbindung gar nicht mehr ankam.